Im Kino
König Jim
Die Filmkolumne. Von Benjamin Moldenhauer
07.11.2023. Babak Jalalis "Fremont" hätte leicht ein Film über Trauma und Verlust werden können. Stattdessen entscheidet sich der Regisseur für die Lakonie und sucht Anschluss an das amerikanische Indiekino der Achtziger und Neunziger.
Hin und wieder funktioniert das Kino auf eine ganz einfache, banale Weise als Zeitmaschine. Nicht, wenn historische Welten detailgenau nachgebaut werden, also nicht über Authentizitätssuggestion. Sondern dann, wenn ein Film eine bestimmte Art, Bilder zu konstruieren und Atmosphären zu entfalten, aus dem Kinowesen einer älteren Dekade entnommen hat, in der und mit deren Filmen man aufgewachsen ist. Die späten Achtziger-, frühen Neunzigerjahre waren die Hochphase des US-Independentfilms. Der wiederum war, bevor er sich in Nullerjahren vollends in alle Richtungen ausdifferenzierte, meist von Figuren bevölkert, die durch idealtypischerweise in Schwarzweiß gehaltene Welten latschten oder stolperten, und Jim Jarmusch war sein König. "Fremont", der vierte Film des iranisch-britischen Regisseurs Babak Jalali, schließt dreißig Jahre später bewusst anachronistisch an diese Ecke des US-Kinos an. Auch narrativ: Der Plot interessiert sich sehr für seine Hauptfigur, aber wenig dafür, mit ihr eine Geschichte zu erzählen. Das war überhaupt ein Merkmal des Independentkinos der Neunziger: die Verabschiedung von mythisch strukturierten Heldenreisen zugunsten eines um die Figuren zentrierten, zerfaserten Geschehens. Das vergleichsweise wenig passiert, trägt zur Lakonie des Ganzen nicht unwesentlich bei.
Jalali schließt also hier an: Jim-Jarmusch-Schwarzweiß, Fokus auf die Menschen, die er zeigt, und nicht auf etwaige Herausforderungen, die bestanden werden müssen, eine ausgeprägt lakonische Haltung zur Welt. Donya (Anaita Wali Zada) ist aus Afghanistan geflohen und in Fremont angekommen, einer Stadt in der Bay Area, in der es eine große Geflüchteten-Community gibt. In Kabul hat sie als Übersetzerin für das US-Militär gearbeitet, ihre Herkunftsfamilie musste sie zurücklassen.
Anaita Wali Zada ist selbst eine Geflüchtete und keine professionelle Schauspielerin. Sie trägt den gesamten Film. Alles in "Fremont" ist um sie herum angeordnet, und damit steht in seinem Zentrum eine Art Leerstelle. Oder besser noch, etwas bewusst Verwischtes, undeutlich Bleibendes. Das von Jalali und der Filmemacherin Carolina Cavalli verfasste Skript achtet penibel darauf, klassische Dreiaktstrukturen zu unterlaufen. Und umfährt auf diesem Wege sehr entspannt allzu naheliegende Trauma-Narrative, die in der Filmfigurenpsychologie ansonsten gerne als Universalerklärungen angeboten werden.

Man erfährt wenig über Donya, die in einer Glückskeksfabrik arbeitet und nach dem Tod einer Kollegin, die wie nebenbei einfach umfällt, zur Autorin für die Kekstexte befördert wird. Alles, was man über Donya wissen kann, muss man aus kleinsten Gesten ablesen. Nervöses Fingertippen auf der Tischplatte, kleine Nuancen in der Stimme, eine kurze Regung in der Mimik. Geredet wird trotzdem sehr viel in "Fremont"; ein weiterer Anknüpfungspunkt an das Kino Jarmuschs.
Man kann ahnen, dass Belastungen und Einsamkeit vorliegen, Donya leidet unter Schlaflosigkeit. Anaita Wali Zada spielt einen Menschen, der kein Interesse hat, etwas von sich preiszugeben und doch auf der Suche nach Verbindung ist. Gebeichtet aber wird nichts. Das klassische moderne Format, um von sich selbst zu erzählen und sich zu offenbaren, die psychotherapeutische Redekur, läuft ins Leere. Donya schummelt sich in die Praxis von Dr. Anthony (Gregg Turkington, der wieder zwischen weirdness und creepiness herumbalanciert), um sich Schlaftabletten verschreiben zu lassen. Der ist begeistert und überredet sie zu weiteren Sitzungen, die allerdings im Wesentlichen darin bestehen, dass der Therapeut schematische Fragen stellt und, einmal unter Tränen, aus seinem Lieblingsbuch vorliest, Jack Londons "Wolfsblut". Die leise Komik speist sich in "Fremont" aus der liebenswerten Dysfunktionalität seiner Figuren.
Damit ist man aber auch bei den ein, zwei Punkten, die einem an diesem Film wie auch an der gesamten Stilgeschichte, die er weiterschreibt, potenziell auf den Glückskeks gehen können: die herausgestellte Skurrilität der Nebenfiguren, die im US-Schwarzweiß-Independentfilm der Jarmusch-Schule gerne in Verbindung gebracht wird mit einem genuin humanistischen, alles akzeptierenden und trotz aller Coolness und lakonischen Abgeklärtheit dem Menschen in seiner Individualität bedingungslos zugewandten Blick. Donya registriert das Treiben um sie herum aufmerksam, aber weitgehend regungslos, und diese Indifferenz ist auch die des Films selbst, der sich sehr darin gefällt, eine Geschichte von Trauma und Verlust so zu erzählen (oder eben nicht zu erzählen), dass alles, was klassischerweise mit beiden Topoi verbunden ist, einfach ausgespart bleibt.
In dieser erzählerischen Offenheit, die verstärkt wird durch das ersatzlose Streichen jeder schematischen Figurenpsychologie (die dann aber nicht durch eine komplexere ersetzt würde, sondern einfach Leerstelle bleibt), gelingen den durchkomponiert-spartanischen Bildern viele wunderschöne Momente. Im letzten Viertel von "Fremont" - dritter Akt klänge schon zu rigide strukturiert - trifft Donya den gleichfalls einsamen Mechaniker Daniel (Jeremy Allen White). Es deutet sich an, als könnte hier ein Ort entstehen, an dem Donya bleiben wollen würde. Aber auch das bleibt, natürlich, offen.
Benjamin Moldenhauer
Fremont - USA 2023 - Regie: Babak Jalali - Darsteller: Anaita Wali Zada, Jeremy Allen White, Gregg Turkington, Hilda Schmelling - Laufzeit: 91 Minuten.
Kommentieren








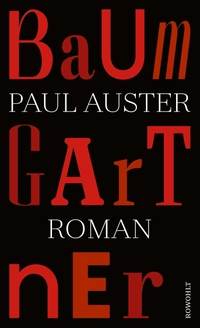 Paul Auster: Baumgartner
Paul Auster: Baumgartner Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung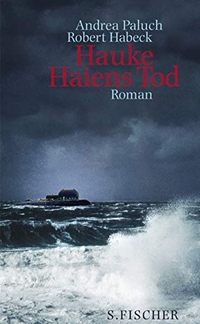 Robert Habeck, Andrea Paluch: Hauke Haiens Tod
Robert Habeck, Andrea Paluch: Hauke Haiens Tod