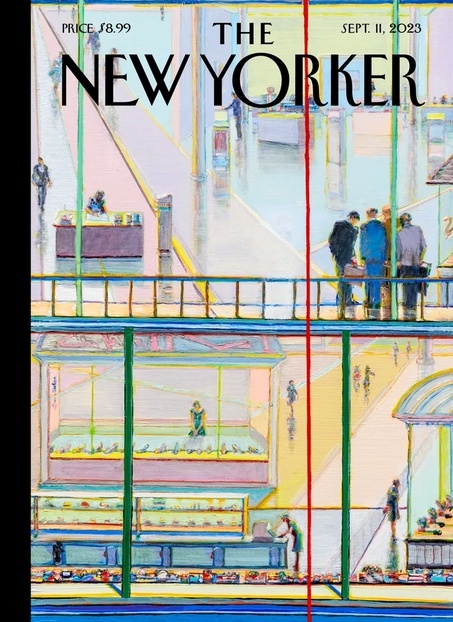
Von den gleichen Motiven wie Michelle Fournet sind auch die Forscher getrieben, die das CETI-Forschungsprojekt betreiben, um mit Hilfe von KI die
Klicklaute der Pottwale zu erlernen. Wenn man Elizabeth Colberts
Reportage liest, möchte man sofort Meeresbiologe werden - oder wenigstens welche kennenlernen, zum Beispiel den Kanadier
Shane Gero, der seit 2005 die Pottwale vor der Antilleninsel Dominica studiert und inzwischen jeden von ihnen
mit Namen kennt. Colbert erlebt sogar
die Geburt eines von hungrigen Grindwalen umkreisten Pottwalbabys. Steven Spielberg könnte das nicht haarsträubender erzählen. Doch zurück zu dem Projekt, das die Westküste Dominicas "in ein riesiges Aufnahmestudio für Wale verwandeln" will. Wenn wir die Grammatik der Laute verstehen, verstehen wir dann wirklich, was die Wale sagen? Nein, erklärt Shafi Goldwasser, die das Simons Institute for the Theory of Computing an der University of California in Berkeley leitet. "'Heutzutage spricht jeder über diese generativen KI-Modelle wie ChatGPT', fährt sie fort. 'Was tun sie? Man gibt ihnen Fragen oder Aufforderungen, und sie geben dann Antworten, indem sie vorhersagen, wie Sätze zu vervollständigen sind oder welches das nächste Wort sein wird. Man könnte also sagen, dass das ein Ziel von CETI ist - dass man nicht unbedingt versteht, was die Wale sagen, aber dass man es mit gutem Erfolg vorhersagen kann. Man könnte also ein Gespräch erzeugen, das
ein Wal verstehen würde, aber vielleicht versteht man selbst es nicht. Das ist also eine Art seltsamer Erfolg.' Vorhersage, so Goldwasser, würde bedeuten, 'dass wir erkannt haben, wie das Muster ihrer Sprache aussieht. Es ist nicht zufriedenstellend, aber es ist etwas.'"
Sehr viel beängstigender liest sich Dana Goodyears
Wissenschaftsreportage über die Möglichkeiten der
Genmanipulation durch CRISPR. Als der chinesische Wissenschaftler He Jiankui 2018 als erster die internationale Vereinbarung durchbrach, CRISPR nicht bei Embryonen einzusetzen, war das Entsetzen groß. "CRISPR versprach, die Medizin zu verändern, indem es einen Weg zur Heilung einer genetischen Krankheit durch Editieren der DNA des betroffenen Gewebes bietet. Diese Form des Editierens wird als '
somatisch' bezeichnet; die Veränderungen, die dabei vorgenommen werden, sind auf den
einzelnen Patienten beschränkt. Beim Editing eines Embryos hingegen wird die DNA der zukünftigen Eizellen oder Spermien des Embryos - seine Keimbahn" - verändert, was zu Veränderungen führt, die
an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden", die dem Probanden schaden und künftige Generationen beeinträchtigen könnten. Deshalb setzte sich unter den Wissenschaftlern ein breiter Konsens durch, vorerst keine vererbbaren Veränderungen am menschlichen Genom vorzunehmen. Doch dieses Einverständnis scheint angesichts der Fortschritte bei CRISPR langsam aufzuweichen, stellt Goodyear fest. Es gibt wirklich
grauenvolle Erbkrankheiten, die man einfach nur ausgerottet wünscht, wie man am Ende der Reportage lesen kann, in dem Goodyear von einer Familie erzählt, deren Tochter am
Batten-Syndrom leidet. Aber es bleiben eben auch die Risiken: "Eine große Sorge ist, dass sich die CRISPR-Schere
nicht vorhersehbar verhält: Wie die Besen in 'Der Zauberlehrling' schneidet sie manchmal das Zielgen und schneidet dann immer weiter, was zu 'Off-Target'-Mutationen führt. Selbst die 'zielgerichteten' Schnitte können negative Folgen haben; das Ausschalten eines Gens kann ein Gesundheitsproblem lösen, aber ein anderes verursachen. (...) In einem Positionspapier aus dem Jahr 2015 mit dem unverblümten Titel 'Don't Edit the Human Germline' argumentierte eine Gruppe von Wissenschaftlern, dass die Kontroverse über das Editing menschlicher Embryonen die Aussichten auf somatisches Editing gefährden würde, das das Leben von Millionen von Menschen retten könnte, die bereits leben und leiden. ... Die Autoren fügten hinzu, dass es ein Leichtes sei, vererbbares Editing für 'nicht-therapeutische Veränderungen' zu nutzen.
Fyodor Urnov, einer der Autoren, sagte: 'Ich nenne Ihnen jetzt drei Anwendungsszenarien, vor denen wir große Angst haben sollten. Befürchtung Nummer eins: die Bewaffnung des Militärs. Wir wissen, wie man einen Menschen herstellt, der mit
vier Stunden Schlaf auskommt - ich kann Ihnen sagen, welche Mutation wir vornehmen müssen. Zweitens: Wir wissen, welches Gen wir verändern müssen, um das
Schmerzempfinden zu verringern. Wenn ich ein Schurkenstaat wäre, der eine nächste Generation von quasi schmerzfreien Soldaten der Spezialeinheiten herstellen will, weiß ich genau, was zu tun ist. Es ist alles veröffentlicht. Und drittens:
Körperliche Stärke. Man braucht keine große Laboroperation. Man braucht nur den bösen Willen.'"
Weitere Artikel: Jackson Arn
stellt anlässlich seiner ersten Retrospektive in Bostons
Museum of Fine Arts den Maler
Matthew Wong vor. Alex Ross
erlebt eine
neue Lisztomanie. Und James Wood
empfiehlt Clare Carlisles "eloquente und originelle"
Eliot-
Biografie "The Marriage Question: George Eliot's Double Life".