Abschlüsse und Neuanfänge
9. Es gibt Tage, an denen die Kinder von Flüchtlingen mit Erzählungen übergossen werden wie mit Wasser aus nie versiegenden Eimern.
So ging es auch mir. Das Erzählte strömte, verstanden und unverstanden, in mich hinein und versickerte in tiefen Gründen. Ihre Kindheit in meine Kindheit. Ihre Geschichten in meine Hellhörigkeit.
Es waren Tage, in denen die Stimmen der angereisten Onkel und Tanten im Verlauf eines Sonntags an Lautstärke zunahmen, wenn Frankfurter Kranz und Biskuitrolle nach dem Kaffeetrinken auf Feldwegen abgelaufen waren und abends die Zungen sich lösten. Wenn man daranging, den mit Rum aus der Festtagskaraffe veredelten Tee zum Brot mit Schweinehack zu trinken. Wenn das Lachen der Männer laut dröhnte und selbst die Frauen hell auflachten.
Abends vor der Abfahrt saßen sie alle um den Tisch herum und waren wieder ganz mutig, anders als noch ein paar Stunden zuvor, als ein Onkel mit fliegendem Jackett vor den Kühen geflüchtet war, ein anderer mit unglücklichem Gesicht grüne Spritzer von den Hosenbeinen geputzt hatte und eine Tante im Entenstall beinahe ausgerutscht und in den Dreck gefallen wäre.
Mich erstaunte ihre Ungeschicklichkeit. Ich dachte, dass sie alle von Rügen kämen, und das hieß für mich: von einem Bauernhof wie dem unsrigen hier, von dem aus matschige Wege in die Felder führten, an Birken und Erlen und Gräben entlang. Wo man im Winter den halben Tag im Dunst von Stall und Scheune verbrachte, mit Kühen und Kälbern und Enten, ihrem Geruch von Milch und Mist, ihrem Schnattern und Muhen und Mähen. Und wo man im Sommer unter weiten, bewegten Himmeln Rüben hackte, Heu machte, Stroh einfuhr, in Staubwolken oder Regengüssen.
Aus meinen Erfahrungen und ihren Worten reimte ich mir Bilder zusammen und wusste dabei nicht, dass die Wittower Bauern eine andere Klasse waren als wir hier im Moor, und auch nicht, dass man den Wegen und Gerüchen der Kindheit so gründlich entwachsen kann. Ich verstand erst später, dass erzählen etwas anderes bedeutet als nur Kenntnis geben über einen anderen Ort und eine andere Zeit.
Wenn sie dann wieder abfuhren, erholten sich die zur Stille gehörigen Stimmen wieder, die der kleineren Tiere, ihr Summen und Fiepen, und die der Pflanzen und Gräser mit ihrem leisen Rascheln im Wind, ihrem lautlosen Aussamen. Alles war wieder hörbar, das zusammen mit noch unzähligem anderen ein Netz aus Beziehungen, Gerüchen und Gesten um Haus und Hof webte, das nur Kinder wahrnehmen, die es als Erwachsene vielleicht auch wieder vergessen werden. Die von den Worten der Erwachsenen durchlöcherte Gegenwart wuchs wieder zusammen. Das Kleine und Stille ließ einen Augen und Ohren wieder feinstellen, und selbst die Dieselmotoren der Trecker störten dabei nicht. Auch die Erwachsenen stellten im Sommer die Motoren auf dem Feld manchmal noch aus, um die Lerchen zu hören.
Es war diese Stille, die der Gegenwart, der Tätigkeiten im Stall und auf dem Feld, der einsamen Wege von hier nach dort, vom Hof zur Schule und zurück, in der, seltsam genug, wieder ein Bedürfnis nach Worten wuchs. Nach anderen Worten vielleicht, die von hier und von uns sprachen und auch verständlich machen könnten, warum wir von dort nach hier gelangt waren.
Was war der wirkliche Grund dafür, dass wir hier als Fremde lebten und nicht auf Rügen?
Da reichte etwas in die Gegenwart hinein, das trotz allem wortlos blieb.
Wenn man vom Kuhstall direkt ins Haus trat, gelangte man zunächst in einen fensterlosen kleinen Raum. Hier zogen wir uns die Gummistiefel und Arbeitsjacken, Schürzen und Kittel aus, die beim Füttern und Melken, Ausmisten und Tränken den gröbsten Schmutz abhielten, und hängten sie an Riegeln zum Trocknen auf. Dieser mit alten Steinkacheln ausgelegte Flur, dessen Fußboden durch das ständige Absinken des Moores an mehreren Stellen eingerissen und gebrochen war, diente als Schleuse zwischen Stall und Haus. Ein Zwischenreich, in dem die Gerüche hängen blieben und von dem aus wir durch die Küche zum Badezimmer gingen. Viele Türen führten von ihm ab, zu Küche und Räucherkammer, zum Dachboden und auf den hinteren, ungeheizten Flur, der zusammen mit zwei Schlafzimmern unter der noch lange mit Stroh gedeckten Seite des Hauses lag.
In diesem dunklen Flur stand ein großer schwarzer Schrank, in dem nie oder selten gebrauchte Kleidung hing, eine Mischung aus Vererbtem und Abgelegtem. Darin warteten, eingemottet und schwer, oft mehrere Kleidungsstücke übereinander, auf ein Kürzen oder Säume- und Nähteauslassen, oder auch nur auf die Kleidersammlung des Roten Kreuzes. Ähnliches galt für das Schuhregal, das neben dem Schrank den Rest der Wand ausfüllte. Dort standen Schuhe und Stiefel, die keinem von uns gehörten oder passten und die nach jedem Frühjahrsputz dennoch immer wieder zurückgestellt werden mussten. Man konnte ja nie wissen, wozu sie noch einmal gebraucht würden. Und tatsächlich suchte und fand meine Mutter dort meist Passendes, wenn die Verwandten aus der Stadt kein Schuhwerk für unsere mit tiefen Pfützen bedeckten, matschigen Wege mitgebracht hatten. Bei solchen Anlässen flüchteten aus den staubigen Schuhen und Stiefeln erschreckte Spinnen in die Dunkelheit der hintersten Winkel, und aus dem knarrend sich öffnenden Schrank drang ein Geruch nach Staub, Mottenkugeln und alter Wolle.
Der Schrank schien in seinem Inneren eine viel tiefere Dunkelheit zu bergen als alle anderen Schränke. Er war so groß, dass mit Leichtigkeit mehrere Kinder darin hätten Platz finden können, und bot sich überhaupt an als Versteck auf Nimmerwiedersehen. Dort hing in einem Kleiderbeutel auch ein seltsames Kleid aus grobem grauem Stoff mit eingewebten bunten Streifen um das tief ausgeschnittene Dekollete und den Saum. Dazu gehörte eine puffärmelige Bluse, eine Art Einsatz, der weiß schimmerte, und eine grobe graue Jacke, wiederum mit bunten Streifen.
"Das ist", so sagte mir meine Mutter einmal etwas unwirsch, als ich danach fragte, "die Rügentracht."
In diesem Kleid stand sie im Oktober 1938 in einer Gruppe von zehn jungen Frauen - sie selbst knapp achtzehn - vor dem Bahnhof in Schivelbein, heute Swidwin. Die anderen jungen Frauen trugen lange Mäntel, unter denen dicke Strümpfe und derbe schwarze Schuhe hervorsahen. Alle lächeln sie - strahlend, schüchtern, erwartungsvoll -, jede auf ihre Art. Ich löse die Fotografie aus dem Album, das ich nach Goor mitgebracht habe; auf der Rückseite ist handschriftlich das Datum vermerkt mit dem Zusatz: "Ankunft in Schivelbein".
Im Zentrum des Bildes steht die einzige ältere Frau, etwa vierzigjährig, in einem Kostüm aus schwerem Wollstoff. Der Hut, über dem linken Auge schräg in die Stirn gezogen, lässt sie aussehen wie eine Jägerin. An ihrem Ärmel ist ein aufgenähtes Abzeichen, und mit Hilfe einer Lupe bestätigt sich, was zu ahnen war: dass es ein Hakenkreuz ist. Die Jägerin ist die Älteste hier, meine Mutter die Jüngste.
Ich habe schon als Kind manchmal in diesem Album, dem zweiten neben dem von Nobbin, geblättert, aber es war ein schnelles, heimliches Blättern. Heute in Goor nehme ich mir Zeit. Für die zwei Bilder zum Beispiel, auf deren Rückseiten in der Handschrift meiner Mutter vermerkt ist: "Unsere Fahne" und "Fahnenhissung - Der Blick aus unserem Schlafzimmer". Beide zeigen die Fahne mit Hakenkreuz und Ähren, eines auch den Kreis der Frauen um den Fahnenmast herum, dazu einen Rasenplatz, rechts ein paar Bäume, im Hintergrund Wirtschaftsgebäude. Ich versuche meine Mutter in dem Kreis auszumachen, den die jungen Frauen um die gerade aufgezogene Fahne herum bilden. Aber da sind sie inzwischen alle schon gleich gekleidet und heben gemeinsam den rechten Arm zum Gruß Richtung Fahne. Das Gesicht meiner Mutter kann ich selbst mit der Lupe nicht mehr erkennen.
Das Arbeitsdienstlager Boltenhagen, heute Belno, lag acht Kilometer westlich von Swidwin, damals Schivelbein. Die Fotos zeigen ein großes zweistöckiges Herrenhaus, den Dachfirst an der Front mit einem Schmuckrelief geziert, die Zinnen einer mittelalterlichen Burg imitierend; an den Seiten streben schmale Erkersäulen nach oben.
Seit 1935 waren alle jungen Männer und Frauen zum Arbeitsdienst verpflichtet und damit aus den Arbeitslosenstatistiken verschwunden.
Teil 2
9. Es gibt Tage, an denen die Kinder von Flüchtlingen mit Erzählungen übergossen werden wie mit Wasser aus nie versiegenden Eimern.
So ging es auch mir. Das Erzählte strömte, verstanden und unverstanden, in mich hinein und versickerte in tiefen Gründen. Ihre Kindheit in meine Kindheit. Ihre Geschichten in meine Hellhörigkeit.
Es waren Tage, in denen die Stimmen der angereisten Onkel und Tanten im Verlauf eines Sonntags an Lautstärke zunahmen, wenn Frankfurter Kranz und Biskuitrolle nach dem Kaffeetrinken auf Feldwegen abgelaufen waren und abends die Zungen sich lösten. Wenn man daranging, den mit Rum aus der Festtagskaraffe veredelten Tee zum Brot mit Schweinehack zu trinken. Wenn das Lachen der Männer laut dröhnte und selbst die Frauen hell auflachten.
Abends vor der Abfahrt saßen sie alle um den Tisch herum und waren wieder ganz mutig, anders als noch ein paar Stunden zuvor, als ein Onkel mit fliegendem Jackett vor den Kühen geflüchtet war, ein anderer mit unglücklichem Gesicht grüne Spritzer von den Hosenbeinen geputzt hatte und eine Tante im Entenstall beinahe ausgerutscht und in den Dreck gefallen wäre.
Mich erstaunte ihre Ungeschicklichkeit. Ich dachte, dass sie alle von Rügen kämen, und das hieß für mich: von einem Bauernhof wie dem unsrigen hier, von dem aus matschige Wege in die Felder führten, an Birken und Erlen und Gräben entlang. Wo man im Winter den halben Tag im Dunst von Stall und Scheune verbrachte, mit Kühen und Kälbern und Enten, ihrem Geruch von Milch und Mist, ihrem Schnattern und Muhen und Mähen. Und wo man im Sommer unter weiten, bewegten Himmeln Rüben hackte, Heu machte, Stroh einfuhr, in Staubwolken oder Regengüssen.
Aus meinen Erfahrungen und ihren Worten reimte ich mir Bilder zusammen und wusste dabei nicht, dass die Wittower Bauern eine andere Klasse waren als wir hier im Moor, und auch nicht, dass man den Wegen und Gerüchen der Kindheit so gründlich entwachsen kann. Ich verstand erst später, dass erzählen etwas anderes bedeutet als nur Kenntnis geben über einen anderen Ort und eine andere Zeit.
Wenn sie dann wieder abfuhren, erholten sich die zur Stille gehörigen Stimmen wieder, die der kleineren Tiere, ihr Summen und Fiepen, und die der Pflanzen und Gräser mit ihrem leisen Rascheln im Wind, ihrem lautlosen Aussamen. Alles war wieder hörbar, das zusammen mit noch unzähligem anderen ein Netz aus Beziehungen, Gerüchen und Gesten um Haus und Hof webte, das nur Kinder wahrnehmen, die es als Erwachsene vielleicht auch wieder vergessen werden. Die von den Worten der Erwachsenen durchlöcherte Gegenwart wuchs wieder zusammen. Das Kleine und Stille ließ einen Augen und Ohren wieder feinstellen, und selbst die Dieselmotoren der Trecker störten dabei nicht. Auch die Erwachsenen stellten im Sommer die Motoren auf dem Feld manchmal noch aus, um die Lerchen zu hören.
Es war diese Stille, die der Gegenwart, der Tätigkeiten im Stall und auf dem Feld, der einsamen Wege von hier nach dort, vom Hof zur Schule und zurück, in der, seltsam genug, wieder ein Bedürfnis nach Worten wuchs. Nach anderen Worten vielleicht, die von hier und von uns sprachen und auch verständlich machen könnten, warum wir von dort nach hier gelangt waren.
Was war der wirkliche Grund dafür, dass wir hier als Fremde lebten und nicht auf Rügen?
Da reichte etwas in die Gegenwart hinein, das trotz allem wortlos blieb.
Wenn man vom Kuhstall direkt ins Haus trat, gelangte man zunächst in einen fensterlosen kleinen Raum. Hier zogen wir uns die Gummistiefel und Arbeitsjacken, Schürzen und Kittel aus, die beim Füttern und Melken, Ausmisten und Tränken den gröbsten Schmutz abhielten, und hängten sie an Riegeln zum Trocknen auf. Dieser mit alten Steinkacheln ausgelegte Flur, dessen Fußboden durch das ständige Absinken des Moores an mehreren Stellen eingerissen und gebrochen war, diente als Schleuse zwischen Stall und Haus. Ein Zwischenreich, in dem die Gerüche hängen blieben und von dem aus wir durch die Küche zum Badezimmer gingen. Viele Türen führten von ihm ab, zu Küche und Räucherkammer, zum Dachboden und auf den hinteren, ungeheizten Flur, der zusammen mit zwei Schlafzimmern unter der noch lange mit Stroh gedeckten Seite des Hauses lag.
In diesem dunklen Flur stand ein großer schwarzer Schrank, in dem nie oder selten gebrauchte Kleidung hing, eine Mischung aus Vererbtem und Abgelegtem. Darin warteten, eingemottet und schwer, oft mehrere Kleidungsstücke übereinander, auf ein Kürzen oder Säume- und Nähteauslassen, oder auch nur auf die Kleidersammlung des Roten Kreuzes. Ähnliches galt für das Schuhregal, das neben dem Schrank den Rest der Wand ausfüllte. Dort standen Schuhe und Stiefel, die keinem von uns gehörten oder passten und die nach jedem Frühjahrsputz dennoch immer wieder zurückgestellt werden mussten. Man konnte ja nie wissen, wozu sie noch einmal gebraucht würden. Und tatsächlich suchte und fand meine Mutter dort meist Passendes, wenn die Verwandten aus der Stadt kein Schuhwerk für unsere mit tiefen Pfützen bedeckten, matschigen Wege mitgebracht hatten. Bei solchen Anlässen flüchteten aus den staubigen Schuhen und Stiefeln erschreckte Spinnen in die Dunkelheit der hintersten Winkel, und aus dem knarrend sich öffnenden Schrank drang ein Geruch nach Staub, Mottenkugeln und alter Wolle.
Der Schrank schien in seinem Inneren eine viel tiefere Dunkelheit zu bergen als alle anderen Schränke. Er war so groß, dass mit Leichtigkeit mehrere Kinder darin hätten Platz finden können, und bot sich überhaupt an als Versteck auf Nimmerwiedersehen. Dort hing in einem Kleiderbeutel auch ein seltsames Kleid aus grobem grauem Stoff mit eingewebten bunten Streifen um das tief ausgeschnittene Dekollete und den Saum. Dazu gehörte eine puffärmelige Bluse, eine Art Einsatz, der weiß schimmerte, und eine grobe graue Jacke, wiederum mit bunten Streifen.
"Das ist", so sagte mir meine Mutter einmal etwas unwirsch, als ich danach fragte, "die Rügentracht."
In diesem Kleid stand sie im Oktober 1938 in einer Gruppe von zehn jungen Frauen - sie selbst knapp achtzehn - vor dem Bahnhof in Schivelbein, heute Swidwin. Die anderen jungen Frauen trugen lange Mäntel, unter denen dicke Strümpfe und derbe schwarze Schuhe hervorsahen. Alle lächeln sie - strahlend, schüchtern, erwartungsvoll -, jede auf ihre Art. Ich löse die Fotografie aus dem Album, das ich nach Goor mitgebracht habe; auf der Rückseite ist handschriftlich das Datum vermerkt mit dem Zusatz: "Ankunft in Schivelbein".
Im Zentrum des Bildes steht die einzige ältere Frau, etwa vierzigjährig, in einem Kostüm aus schwerem Wollstoff. Der Hut, über dem linken Auge schräg in die Stirn gezogen, lässt sie aussehen wie eine Jägerin. An ihrem Ärmel ist ein aufgenähtes Abzeichen, und mit Hilfe einer Lupe bestätigt sich, was zu ahnen war: dass es ein Hakenkreuz ist. Die Jägerin ist die Älteste hier, meine Mutter die Jüngste.
Ich habe schon als Kind manchmal in diesem Album, dem zweiten neben dem von Nobbin, geblättert, aber es war ein schnelles, heimliches Blättern. Heute in Goor nehme ich mir Zeit. Für die zwei Bilder zum Beispiel, auf deren Rückseiten in der Handschrift meiner Mutter vermerkt ist: "Unsere Fahne" und "Fahnenhissung - Der Blick aus unserem Schlafzimmer". Beide zeigen die Fahne mit Hakenkreuz und Ähren, eines auch den Kreis der Frauen um den Fahnenmast herum, dazu einen Rasenplatz, rechts ein paar Bäume, im Hintergrund Wirtschaftsgebäude. Ich versuche meine Mutter in dem Kreis auszumachen, den die jungen Frauen um die gerade aufgezogene Fahne herum bilden. Aber da sind sie inzwischen alle schon gleich gekleidet und heben gemeinsam den rechten Arm zum Gruß Richtung Fahne. Das Gesicht meiner Mutter kann ich selbst mit der Lupe nicht mehr erkennen.
Das Arbeitsdienstlager Boltenhagen, heute Belno, lag acht Kilometer westlich von Swidwin, damals Schivelbein. Die Fotos zeigen ein großes zweistöckiges Herrenhaus, den Dachfirst an der Front mit einem Schmuckrelief geziert, die Zinnen einer mittelalterlichen Burg imitierend; an den Seiten streben schmale Erkersäulen nach oben.
Seit 1935 waren alle jungen Männer und Frauen zum Arbeitsdienst verpflichtet und damit aus den Arbeitslosenstatistiken verschwunden.
Teil 2








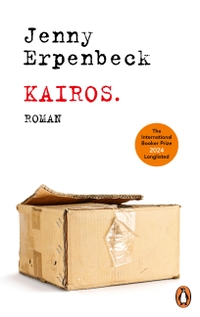 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung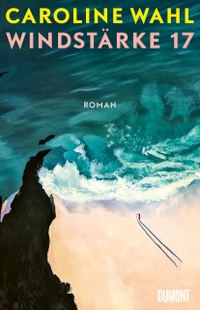 Caroline Wahl: Windstärke 17
Caroline Wahl: Windstärke 17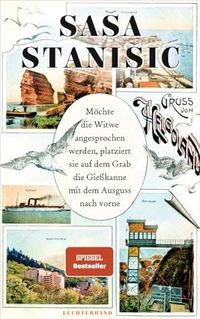 Sasa Stanisic: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne
Sasa Stanisic: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne