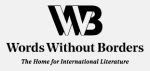
Die portugiesische
Autorin Lídia Jorge spricht im
Interview mit Margara Russotto und Patrícia Martinho Ferreira über ihre Arbeit und über die Veränderungen in der portugiesischen Gesellschaft, besonders bei den Frauen, deren Zeugin sie war: "Was den sozialen Wandel betrifft, so hat die Tatsache, dass Portugal
nach der Revolution Teil Europas wurde, ein Land, das an zu vielen archaischen Überzeugungen festgehalten hatte, stark belastet, und der schnelle Weg, den es einschlagen musste, hat tiefe Konflikte innerhalb der portugiesischen Gesellschaft zutage gefördert. Ich gehöre zu der Gruppe von Schriftstellern, die diesen sozialen und historischen Wandel
buchstäblich sichtbar gemacht haben, aber aus der Innenwelt der Figuren, durch veränderte individuelle Sichtweisen. Wenn ich eine Inschrift entwerfen müsste, die alles umfasst, was ich bisher geschrieben habe, würde ich sagen: In diesen Büchern geht es um eine Zeit, in der die
Idee des Imperiums verblasste und eine freie Gesellschaft aufkam. ... Natürlich habe ich auch andere Perspektiven in Betracht gezogen, wie den Wandel der Familie und die Rolle der Frau, wie sie mit den Veränderungen in Portugal und den Veränderungen in Europa und der Welt konfrontiert waren. In den 1960er Jahren war
eine von drei portugiesischen Frauen
Analphabetin, was eine Menge über eine Gesellschaft aussagt. Trotz dieser Geschichte der geringen Bildung und des Festhaltens an überholten Vorstellungen haben viele portugiesische Frauen bewiesen, dass sie frei und Herr über sich selbst sein wollten. Andere, vielleicht viele andere, blieben Gefangene eines schwierigen Erbes. Ich möchte diese soziologischen Aspekte des portugiesischen Lebens nicht mit der Literatur verwechseln, aber dennoch muss ich erwähnen, dass portugiesische Schriftstellerinnen diesem Thema Tausende von Seiten gewidmet haben. Es ist unmöglich, gegenüber den entrechteten Mitgliedern einer Gesellschaft gleichgültig zu sein, in der das Erbe der Unterdrückung am stärksten zu spüren ist.
Schreiben ist ein Blutstrom, der von Körper zu Körper geht."
Der amerikanische
Autor Jaroslav Kalfař erinnert sich daran, wie er nach dem Zerwürfnis mit seinem Vater als Teenager seiner Mutter
von Tschechien nach Amerika folgte. Sein Vater hielt nie etwas von seinem Interesse für Literatur (sein Stiefvater in Amerika auch nicht) und prophezeite ihm
komplettes Versagen, zumal der junge Jaroslav kein Englisch konnte: "In einigen Dingen hatte mein Vater recht. Obwohl ich nie zurückkehrte, um ihn um Vergebung zu bitten, waren meine ersten Jahre in den Vereinigten Staaten weitaus schwieriger, als ich es mir hätte vorstellen können. In der High School hatte ich Angst, überhaupt zu sprechen und erntete dafür Misstrauen und Spott von meinen Mitschülern. ... Ich wollte das Schreiben aufgeben. Aber ich tat es nicht. Stattdessen vertiefte ich mich in die gleichen parasitären kreativen Aktivitäten, die mir mein Vater vorwarf. Ich las die tschechischen Romane, die ich mit nach Amerika gebracht hatte, immer wieder -
Asimovs "I, Robot",
Čapeks "War with the Newts",
Le Guins "The Dispossessed". In der Bibliothek lieh ich mir die
englischen Versionen dieser Romane aus und las sie Seite an Seite, so dass meine Geburtssprache und meine Adoptivsprache nebeneinander lagen. Ich verglich die Unterschiede in der Syntax und erforschte die Nuancen des Vokabulars. Schließlich kehrte ich zu den handgeschriebenen Kurzgeschichten zurück, die ich aus der Tschechischen Republik mitgebracht hatte. Ich verbrachte Stunden damit, meine Werke ins Englische zu übersetzen, unbeholfen und mit Ergebnissen, die im Nachhinein lächerlich sind. Aber es funktionierte. Zwischen diesem literarischen Streben und der Umgangssprache der Fernsehsendungen und meiner weitaus cooleren Highschool-Kollegen, zwischen dem Zwang, mit den Kunden zu scherzen, denen ich bei Friendly's Eis servierte, und dem Erreichen einer Zwei in meinem ersten Aufsatz am Community College - ein B- in Englisch, was für ein Traum - begann meine neue Sprache einen Sinn zu ergeben. Sie wurde
instinktiv.
Lebendig."