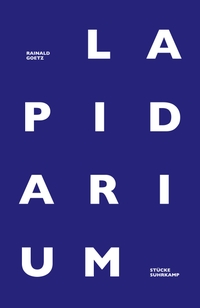Klappentext
LAPIDARIUM ist ein Buch mit drei Theaterstücken, die sich der Dunkelmaterie im Mensch des frühen XXI. Jahrhunderts zuwenden: Folter, Terror, Suizid. Im Gesellschaftsstück REICH DES TODES wird der politische Prozess gezeigt, der von 9/11, dem islamistischen Terroranschlag, zur systematischen Folter von Kriegsgefangenen in den US-amerikanischen Lagern von Guantánamo und Abu Ghraib geführt hat. Am Extremfall des Versagens demokratischer Herrschaft im führenden Staat der westlichen Welt, in den USA, zeigt sich beispielhaft POLITISCHE THEORIE. Das Familienstück BARACKE verfolgt den Lebenslauf der Liebe, der vom Verliebtsein zu einem Kind führt, das Vater und Mutter erschafft, die Enge der kleinen neobürgerlichen Kleinfamilie, den Stumpfsinn, Gewalt im Inneren, im Keller des Hauses, Gewalt als politisch deklarierte Tat, bis hin zu den Morden, die der NSU, auch in Bezug auf die Taten der RAF, begangen hat. Die Energien, hier in Deutschland, die das hervorbringen: DIE ELEMENTAREN STRUKTUREN DER VERWANDTSCHAFT. Das Ichstück LAPIDARIUM: Selbstporträt, Tagebuch der letzten Tage, Alter, Freundschaft, Tod. Der Tod erscheint dem Ich, die Sterbenden, die Toten, und mit den gegenwärtigen die früheren Jahre, Bilanz, im bayrischen Süden, Mai und November 2023, für Franz Xaver Kroetz. Wie wollen wir sterben, wie leben? Entwurf einer ANTHROPOLOGIE IN PRAGMATISCHER ABSICHT.
BuchLink. In Kooperation mit den Verlagen (Info
):
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 24.05.2024
Rezensent Till Briegleb ahnt, dass Rainald Goetz wie dunnemals jede Menge Spaß haben wird bei der Uraufführung seines neuen Stücks. Briegleb erinnert sich an Festung und Katarakt und findet das neue Drama weniger theatermäßig, wenngleich die Goetz-Geister Dietl, Kroetz, Stucki und Albert Oehlen ihren Auftritt haben in diesem Monolog eines sich erinnernden Alten. Es geht um Formen der Intellektualität, meint Briegleb, aber auch um Eitelkeiten und um den Tod. Etwas bang fragt sich der Rezensent: Ist hier ein Drift dieses hyperhektischen Schreibens hin "zum Erschöpften" zu erkennen?
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deRezensionsnotiz zu Die Welt, 24.05.2024
Heute wird Rainald Goetz siebzig Jahre alt, Mladen Gladic gratuliert und spricht über die beiden neuen Bände, die zu diesem Anlass im Suhrkamp-Verlag erschienen sind: Goetz ist für Gladic immer absolute Gegenwart, kein anderer Autor vermag es, den jeweiligen Zeitgeist so einzufangen, versichert er. "Wrong" ist nicht ausschießlich gegenwärtig, versammelt der Band doch Texte und Interviews von 2006 an, für die Leser ist aber doch vieles dabei, das sich als Zeitdiagnose lesen lässt, etwa zur stetigen Beschleunigung von Texten, Bildern und Reaktionen im Internet. Nicht nur um das eigene Poetik-Verständnis des Autors geht es, sondern auch das Verhältnis von Körper und Geist und um moralische Fragen etwa zum Suizid des Schriftsteller-Kollegen Wolfgang Herrndorf. Dazu lassen sich ergänzend auch gut die Stücke in "Lapidarium" lesen, die den Kritiker bisweilen an Peter Handke erinnern.
Rezensionsnotiz zu Die Zeit, 23.05.2024
Ein wenig starr in ihrem strengen Urteilen über Menschen ist die in diesem Band versammelte jüngere Dramatik Rainald Goetz' gelegentlich, urteilt Rezensent Peter Kümmel. Kümmels Rezension konzentriert sich auf das titelgebende Stück, in dem es darum geht, das jemand seinen Nachlass sortiert. Dieses - eines von dreien hier versammelten - behandelt nicht Lebende wie bereits Tote, sondern schenkt den Toten noch einmal Leben, freut sich der Rezensent.
Rezensionsnotiz zu Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.05.2024
Zwei neue Bücher von Rainald Goetz, dem "Autor der Gegenwärtigkeit", hat Rezensentin Julia Encke vor sich, den Band mit den Stücken erwähnt sie nur kurz, um auf die Sammlung an Texten, Notaten und Reden einzugehen, deren Impulse sie dem Titel entsprechend ziemlich oft "wrong" findet. Goetz beziehe sich darin auf Kollegen wie Nora Bossong und Maxim Biller, um eine Vermischung von Literatur und Politik zu beklagen, die keinem der beiden Bereiche gerecht werde. Auch die moralisierte Bewertung von Wolfgang Herrndorfs Suizid stößt Encke sauer auf und passt für sie nicht in Goetz' programmatische Selbstverpflichtung, nicht schlecht über andere Schriftsteller zu sprechen. Außerdem missfällt der Kritikerin der Früher-War-Alles-Besser-Gestus, was sie nach dieser Lektüre "ratlos" zurückbleiben lässt.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.de
Kommentieren