Michal Witkowski
Lubiewo
Roman
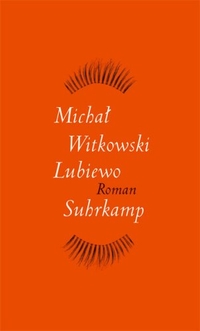
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007
ISBN 9783518419298
Kartoniert, 338 Seiten, 19,80 EUR
ISBN 9783518419298
Kartoniert, 338 Seiten, 19,80 EUR
Klappentext
Aus dem Polnischen von Christina Marie Hauptmeier. Der Badestrand Lubiewo an der polnischen Ostseeküste war seit den siebziger Jahren ein Mekka der Homosexuellen. Hier haben auch Patrycja und Lukrecja, zwei "Tunten", ihre schönsten Sommer verbracht. Seit dem Untergang der "Kommune", wie die kommunistische Zeit in Polen genannt wird, ist der Strand von emanzipierten, sportlichen gays und solariumsgebräunten, tätowierten Lederschwulen bevölkert, die nichts mehr wissen vom Herumstreunen auf der Straße, vom Dreck, von der Anonymität und demütigenden Unterwerfung. Von einem Begehren, das Kraft gab, zu leben und zu träumen. Lukrecja und Patrycja stehen auf luje, auf "Kerle", maskuline Heteros, die es auf möglichst raffinierte Weise zu verführen gilt: "Einer mit Abitur ist kein richtiger Kerl." Sie wollen weder Partnerschaft noch soziale Anerkennung. Ihr Platz in der Gesellschaft war die Klappe. Heute gehen sie sonntags zur Kirche, wie alle Frauen ihres Alters. Lubiewo, der "Große Atlas der polnischen Tunten", setzt ihnen ein Denkmal - wie auch dem Krankenpfleger Jessica, der an Aids stirbt, dem slowakischen Strichjungen Di am Wiener Westbahnhof und vielen anderen.
Rezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 16.10.2007
Beeindruckt zeigt sich Rezensent Ulrich M. Schmid von Michal Witkowskis Roman über die polnische Schwulenszene mit ihren alternden Tunten, jungen Knaben und verwzeifelten Rotarmisten. Jenseits einer "soziologischen Bestandsaufnahme" schwuler Idealtypen schildere Witkowski die queere Parallelwelt mit "rückhaltloser Offenheit", warnt Schmid, der zugleich konstatiert, dass Witkowski die lietrarisch angemessene Form für das fragmentierte Leben gefunden haben, indem er verschiedene Textsorten, wie E-Mail, Essay oder Reportage vermische. Rezensent Schmid versteht hier die Homosexualität als "Chiffre" für das heutige Leben überhaupt, in dem das Ich, zwischen "Geschlechtstrieb, Geldnot und Schicksal hin und her geworfen", nur noch kurzfristige Befriedigung findet. Ethisch nicht ganz unproblematisch findet der Rezensent dies, betont aber, dass sich Witkowski dessen bewusst sei. Gerade deshalb, so vermutet er, habe der Autor seine Figuren als "tragische Helden" modelliert, die nur besonders extreme Beispiel des Menschen der Gegenwart sind.
Rezensionsnotiz zu Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.10.2007
Zwei Lesarten dieses Romans stellt die Rezensentin Stefanie Peter vor. Die eine wäre, dieses Buch als Schwulenroman zu lesen, ihm eine Verwandtschaft mit Hubert Fichtes Werk anzudichten, wie es der Verlag tue. Die andere aber, von der die Rezensentin bei weitem überzeugter ist, wäre, ihn als Abgesang auf die kommunistischen, sprich repressiven Zeiten, und damit als Kritik am globalisierten Kapitalismus zu rezipieren. Authentizität des Begehrens fände dann - wie Witkowski es sehe, und darin seinem Landsman Stasiuk ähnlich sei - nur in der Provinz statt, im "toten Winkel" der neuen Gesellschaft. So gelesen ist für Witkowskis Tunten der alten Zeit die neue Ästhetik der schönen Körper gleichgesetzt mit Urbanität und Vernunft. Und das hieße für sie und auch ihren Autor, mit einem unwahren Leben. Stefanie Peters kommt zu dem Schluss, dass diese Lesart des Romans ihn zu einem "antipolitischen" macht - und das scheint ihr wiederum gut zu gefallen.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deRezensionsnotiz zu Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.10.2007
Ein "Denkmal" für die Tunten Polens sieht Eberhard Rathgeb in Michal Witkowskis Roman "Lubiewo", der in Polen einen Skandal auslöste, wie er in der FAZ am Sonntag schreibt. Das Buch vermittelt für ihn - "quirlig, ungeniert und nackt" - ein plastisches Bild vom Außenseitertum der Tunten im Osten Europas , deren Dasein sich vom bürgerlich-liberalen Leben der konsumorientierten, körperbewussten, finanziell besser gestellten Gays im Westen deutlich unterscheidet. Er liest das Buch als einen Bericht über das Leben einer Reihe von Tunten, die im dunklen Park cruisen, in Pissiors schnellen Sex suchen und immer wieder dem Hass und Gewalt von Skinheads und Polizisten zum Opfer fallen. Dabei lässt Rathgeb keinen Zweifel daran, dass die "traditionelle Männer(sex)welt" von Witkowskis Tunten mit ihrer Lust auf sich selbst und auf den Körper nur scheinbar und für Momente aus den Angeln gehoben wird, um dann "umso schwerer wieder ins Schloss zu fallen".
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deThemengebiete
Kommentieren







