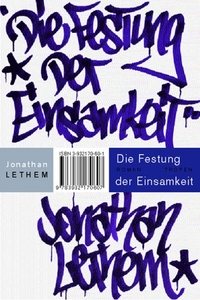Klappentext
Aus dem Amerikanischen von Michael Zöllner. Anfang der siebziger Jahre ziehen die ersten weißen Hippiefamilien ins Zentrum Brooklyns, das zu der Zeit überwiegend von Schwarzen und Puertoricanern bewohnt wird. Dylan, der schüchterne Sohn des Malers Abraham Ebdus und dessen Frau Rachel sieht sich mit dem Umzug der Familie in eine bedrohliche Welt versetzt. Jede Zuneigung muss er sich erkämpfen wie das Stück Asphalt beim Spielen auf der Straße. Dennoch versucht seine Mutter ihn mit aller Macht in dem Viertel, in dem sie selbst aufwuchs, zu integrieren. Als sie eines Tages verschwindet und sich der Vater in die abstrakte Welt seiner Malerei flüchtet, ist der achtjährige Dylan auf sich allein gestellt...
Rezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 09.02.2005
Seit der Veröffentlichung von "Motherless Brooklyn" 1999 gehört Jonathan Lethem zu den wichtigsten US-amerikanischen Schriftstellern seiner Generation, stellt Rezensent Thomas David den Autor vor. Aufgewachsen in der Hippie-Boheme von Brooklyn, beschwört Lethem in seinem neuen Roman das Milieu seiner Kindheit noch einmal herauf. In der Hauptfigur Dylan, einem weißen Jungen, der in farbiger Umgebung aufwächst, prallen raues Street Life und intellektuelles Elternhaus aufeinander. Erzählt wird in "Die Festung der Einsamkeit" von den Songs, die Dylan gemeinsam mit seinem Freund Mingus hört, den Filmen, die sie sehen, von American Graffiti und den Helden der amerikanischen Comic-Kultur, die beide verehren. Gemischt wird dieser detailreiche Realismus mit einer grellen Fantastik, was auf wunderbare Weise gelingt, wie der Rezensent zufrieden feststellt. Der Roman strahle trotz seiner Lebendigkeit eine Melancholie aus, die dem Bewusstsein um die Endlichkeit der Dinge entspringe.
Rezensionsnotiz zu Frankfurter Rundschau, 08.12.2004
400 Seiten lang glücklich und am Ende unsanft aus dem Paradies vertrieben - so erging es Christoph Schröder bei der Lektüre von Lethems bislang ehrgeizigstem und persönlichsten Buch (Marke dicker Wälzer, der die ganze Welt erfasst). Dylan, die Hauptfigur, wächst wie der Autor im Brooklyn der Siebziger auf, ein weißer Junge in einem schwarzen Viertel, und die Erzählung der Kindheit nimmt den Teil des Buches ein, dem der ganze Schwärmerei des Rezensenten gilt: "Unfassbar gut" sei es, was Lethem da leiste, mit welcher "Sinnlichkeit" und "Fülle an Details" er die vergangene Welt heraufbeschwöre und einen "geradezu klassischen Bildungroman" auf das Pflaster von Brooklyn projiziere. Und diese "Gänsehaut-Sätze, die Atmosphäre erzeugen, plausibel und ortsunabhängig"! Doch leider folgen darauf noch einmal mehr als 200 Seiten, in denen der Roman von der "multiperspektivischen Erzählhaltung" in die Ich-Form wechselt und dabei zum Bedauern des Rezensenten seinen Zauber verliert. Klar, es war vielleicht notwendig, die Nostalgie des ersten Teils zu durchbrechen und dem "Epos" von Kindheit und Freundschaft die "radikale Selbstbefragung" folgen zu lassen - Dylan ist mittlerweile Mitte dreißig und steckt in einer Identitätskrise. "Unverzeihlich" sei dagegen "der qualitative Absturz, den Lethem dafür in Kauf nimmt" - aus Figuren werden Vehikel von Dylans "Nostalgieaustreibung". Und dennoch bleibt Schröder dabei: "eine der seit langem bezauberndsten Beschwörungen einer versunkenen Welt". Und "brillant" übersetzt!
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 20.10.2004
Schon Jonathan Lethems letzter Roman "Motherless Brooklyn" hatte Sebastian Handke nach eigener Aussage sehr begeistert, doch nun muse er feststellen, dass dieses Genrestück nur eine Vorstudie zu Lethems neuem Roman "Die Festung der Einsamkeit" gewesen sein muss, den Handke schlicht als "großen Wurf" tituliert. Ein Bildungsroman, der stark autobiografische Bezüge hat, versichert der Rezensent, und der eine teilweise romantische Heraufbeschwörung der 70er Jahre, eine sanfte Abrechnung mit den Gepflogenheiten der Hippies und der künstlerischen Avantgarde sowie ein spannendes Portrait des New Yorker Stadtteils Brooklyn in jener Zeit darstellt. "Motherless Brooklyn" seien auch die beiden männlich-jugendlichen Protagonisten, Dylan und Mingus, so Handke, weiß der eine, schwarz der andere, und um ihre Entwicklung und Beziehung, die dem Erwachsenenleben nicht standhält, geht es auch u.a. in dem Roman, berichtet Handke. Nirgendwo seien die beiden Jungen zu Repräsentanten ihres Milieus oder ihrer Rasse degradiert, betont er und hebt die Ideenfülle, das Phantasievolle des Romans hervor, der zugleich äußerst genaue Milieubeschreibungen liefere. Bloß der letzte Teil des Romans fällt laut Handke ziemlich ab, in dem Lethem aus unerklärbaren Gründen die Einheit des Romans sprenge und diesen damit seine Eleganz, seine Balance verlieren lasse - aber eben nur beinahe.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deRezensionsnotiz zu Die Tageszeitung, 29.09.2004
Für einen großen Wurf hält Jochen Förster den neuen Roman des 40-jährigen "Neo-Franzen aus Brooklyn", wie der Rezensent den Autor Jonathan Lethem charakterisiert. Bislang habe Lethem eher skurrile Genre-Kolportagen geschrieben, die hierzulande teilweise gar nicht erst übersetzt wurden, weiß Förster, weil diese Art Literatur in Deutschland, die von der Montage aus Science Fiction, Krimi- und Comicelementen lebt, nur wenige Abnehmer finde. Doch mit der "Festung der Einsamkeit" verhält es sich anders, prophezeit Förster, das Buch sei viel autobiografischer, ernster, aus einer Notwendigkeit heraus geschrieben. Der Roman schildert, um es kurz zusammenzufassen, das Schicksal zweier Freunde, die, beide von ihren Hippieeltern mehr oder weniger im Stich gelassen, in der Bronx aufwachsen, ungewöhnlich genug für das weiße Kind, das diese Sozialisation auf der Strasse seinen revoltierenden Eltern verdankt. Die Poesie dieser Kindheits- und Jugendjahre gehört zum Schönsten des ganzen Romans und zum Schönsten überhaupt, schwärmt Förster, was über diese Phase jemals geschrieben worden sei. Um so gnadenloser falle dann auch das Herauswachsen aus dieser Zeit aus, das der Roman in großen Sprünge verfolge. Höchst beeindruckt zeigt sich Förster, wie Lethem zwei höchst unterschiedlich verlaufende Biografien verfolgt und in einer klaren Sprache den großen Bogen spannt, der so vieles auf einmal abhandelt: Rassentrennung, Stadtentwicklung, das Scheitern der Utopien, Abschied von der Kindheit.
Kommentieren