Clarin
Sein einziger Sohn
Roman
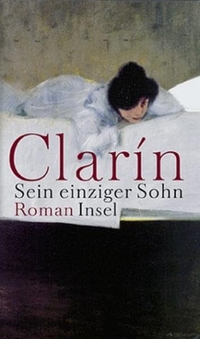
Insel Verlag, Frankfurt am Main 2002
ISBN 9783458171041
Gebunden, 309 Seiten, 24,90 EUR
ISBN 9783458171041
Gebunden, 309 Seiten, 24,90 EUR
Klappentext
Aus dem Spanischen von Elke Wehr. Als eine Operntruppe in die "melancholische drittklassige Provinzhauptstadt" kommt, wo Bonifacio Reyes mit seiner autoritären, egoistischen Frau Emma wohnt, hofft er, endlich seine romantischen Ambitionen verwirklichen zu können. Er nähert sich der Sängerin Serafina... Clarins Roman, angesiedelt in den sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, ist die Geschichte eines Antihelden, der seine eigene Wirklichkeit beständig in Fiktion verwandelt und dessen Weltfremdheit und Selbstentfremdung in dem Wunsch nach einem Sohn gipfeln, seinem einzigen Sohn, der seinem Leben einen Sinn geben und ihn letzten Endes unsterblich machen soll.
Rezensionsnotiz zu Frankfurter Rundschau, 17.08.2002
"Wundervoll bizarr" findet Hannelore Schlaffer dieses "Gesellschaftsgemälde", das Leopoldo Alas y Urena (1852 bis 1901), der unter dem Pseudonym Clarin veröffentlichte, 1891 geschrieben hatte und das nun erstmals in deutscher Übersetzung vorliegt. Darin geht es, berichtet die Rezensentin, um die Liebesgeschichte "des an Körper und Geist winzigen Bonifacio Reyes". Der, in einem spanischen "trostlosen" Provinznest ansässig, verliebt sich in eine Primadonna, was seine Ehefrau mit erstaunlicher Gelassenheit aufnimmt, führt Schlaffer weiter aus. Dem Autor, schwärmt die Rezensentin, ist es gelungen, wie ein "Bänkelsänger" von den äußeren wie inneren "Moritäten der Menschen" zu erzählen und mit seinem "ästhetischen Luchsauge" "Verschiebungen", "Verdrängungen", "phallokratische Zeichengebung" und "homosexuelle Neigungen" in den Blick zu nehmen, wie es erst später die Psychoanalyse getan hat. Und wer will sich außerdem, so Schlaffer, "eine der seltsamsten Szenen der Weltliteratur" entgehen lassen, nämlich eine Kitzelorgie der Ehefrau mit der Geliebten - für die Rezensentin zweifellos der "Höhepunkt" dieser "sonderbaren comedie humaine".
Rezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 08.06.2002
Albrecht Buschmann ist von diesem Werk des spanischen Autors Leopoldo Alas (1852 bis 1901), der seine Romane unter dem Pseudonym Clarin verfasste, hin und weg. "Wer einmal sehen möchte, wie unaufdringlich elegant ein allwissender Erzähler agieren, wie perfekt Tempi und Perspektiven, Szenenwechsel und noch Nebenfiguren inszeniert sein können - in diesem Meisterwerk der Erzählkunst des 19. Jahrhunderts lässt es sich studieren", schwärmt der Rezensent. Denn hier gehe es nicht, wie so oft im "standardisierten" Roman des 19. Jahrhunderts, um "Tuberkulose für die Dame" und das "Duell für den Herrn", sondern um die zunehmende "Entblößung" eingefahrener Lebensstrukturen, so Buschmann. Ein Pantoffelheld verliebt sich in eine Sopranistin, seine Ehefrau nimmt es gelassen und lässt sich mit einem Bariton ein, die Sopranistin wiederum tauscht mit Begeisterung ihr wildes Theaterleben mit einem häuslichen Dasein, erzählt der Rezensent. Selten, erklärt er staunend, war ihm ein Roman, von dem ihn 110 Jahre trennen, "so nah, so lebendig, so liebevoll böse" und "furchtbar gegenwärtig". Ein großes Lob spendet Buschmann auch der "ungekünstelten" Übersetzung von Elke Wehr.
Rezensionsnotiz zu Die Zeit, 29.05.2002
Thomas Köster ist begeistert, dass es diesen 1891 erschienen Roman nun endlich auch auf Deutsch zu lesen gibt - und das in blendender Übersetzung! Genüsslich gibt Köster die Handlungskonstellation wieder (Bonifacio Reyes betrügt seine scheinkranke Ehefrau mit einer Sopranistin und vermag es nicht, sich zu entscheiden - auch nicht, als sich seine Frau einen Liebhaber nimmt und von ihm schwanger wird) und erfreut sich an Clarins Formulierungen. Gegen den verführerischen Vergleich mit Flaubert allerdings sträubt er sich ein wenig. Clarins "Sittengemälde der Provinz" sei "bitterer als das Flauberts": er seziere seine Figuren nur, um deren Leere zu offenbaren, eine Leere, die im Selbstbetrug enden muss. Grandios, findet der Rezensent, ein "Meisterwerk".
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 16.05.2002
Roger Willemsen jedenfalls hat das Buch gelesen und nicht bloß den Klappentext, der, wie er schreibt, zwei Drittel der Handlung vorwegnimmt. Zu merken ist das an seinem Enthusiasmus und an der Kenntnis, mit der er diesen zweiten, nach 111 Jahren erstmals auf Deutsch (übersetzt von der eigens gelobten Elke Wehr) erscheinenden Roman Clarins vorstellt. Das Buch kommt als Porträt einer Frau in der Provinz (Bovary!) daher und variiert das bekannte Motiv vom Einbruch des Künstlerischen in die Welt der Bürgerlichkeit. Wie prägnant und eindringlich Clarin die Ebenen sich mischen lässt, den Dualismus überwindet, das hält Willemsen für groß. Derart, dass er Paul Ingendaays Verdikt in der FAZ vom "bestechendsten spanischen Romanschriftstellers seit Cervantes" gern wiederholt. Soll der Spott bei Clarin ruhig etwas weniger beißen als bei Flaubert, die Versenkung in die Lüste gehemmter sein als bei Baudelaire - wenn das Buch in der zweiten Hälfte übergeht ins Psychiatrische und Amoralische, so Willemsen, spürt der Leser, was für ein "tückisches, ein dämonisches Buch" er in Händen hält.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deThemengebiete
Kommentieren







