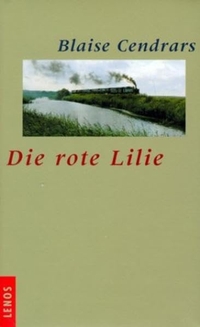Klappentext
Aus dem Französischen von Gio Waeckerlin Induni, mit einem Nachwort von Peter Burri. Von 1945 bis 1949 publiziert Blaise Cendrars in Paris vier Bücher, in denen er in Romanform wichtige Stationen seines intensiven Lebens Revue passieren lässt. Der zweite Band dieses losen Zyklus, der 1946 erscheint, ist dabei von zentraler Bedeutung: Der aus der Schweiz stammende Wahlfranzose Cendrars erinnert sich an den Ersten Weltkrieg, in dem er als Freiwilliger bei der Fremdenlegion gegen Deutschland kämpfte und 1915 seinen rechten Arm verlor. So gab er diesem Buch den Titel La main coupee, obwohl dieses einschneidende Erlebnis darin nur in einer kurzen Vision (im Kapitel "Die rote Lilie"), die dieser deutschsprachigen Erstausgabe den Titel gibt. Cendrars beklagt sich in diesem Erlebnisbericht von der damaligen Front nicht sich selber, sondern schildert auf atemberaubende Weise, wie sich ein kleines Corps von Männern, die aus aller Welt kamen, um die Kulturnation Frankreich zu retten, in den Schützengräben mit allerlei Tricks am Überleben hielt - nicht nur gegen den deutschen Feind, sondern auch gegenüber der französischen Bürokratie. Ein Buch, das auch heute noch Aufschluss darüber gibt, was Krieg bedeutet: für die, die ihn (freiwillig oder nicht) an der Front mitmachen und die Aussichtslosigkeit militärischer Strategien am eigenen Leib erfahren.
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 08.02.2003
In seinem 1946 erschienen Gedichtband "La main coupee" (die abgeschnittene Hand) komme Cendrars, der im Ersten Weltkrieg als Frontsoldat eine Hand verlor, auf seine Kriegserlebnisse zurück, erklärt der Rezensent Volker Breidecker. Der Titel der deutschen Übersetzung, "Die rote Lilie", so Breidecker weiter, folge der Überschrift eines kleinen Abschnittes, in dem Cendrars "eine geheimnisvoll verschlüsselte Schilderung des Schicksals seiner Hand" liefere, die in ihrem Verschwinden so "surreal" und so "phantastisch" wie die "Wirklichkeit des Krieges" erscheine. Überhaupt sei der "Heldentod" in Cendrars Text abwesend, Parole sei hier das zynische "marschiere oder krepiere". Doch auch die Zeit sei gewissermaßen tot, und der "Cafard", der sehnsüchtige "Trübsinn", breche über die im "ewigem Warten, endlosem Nichtstun" und in der "erdrückender Langeweile" gefangenen Soldaten herein, die sich nur mit "Boche-Schießen" und "Lausbubenstreichen" über Wasser halten könnten. Und so sei dieser Band auch ein Buch der Freundschaft zwischen mürbe gewordenen "hysterisch empfindsamen" Männern, keinen Kriegshelden. Cendrars "Legionärslieder", so Breidecker, sind "volltönende Melodien", die "wie Sperrfeuer ins Literaturkontor" daherkommen.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deRezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 02.10.2002
Zu einer umfassenden Cendrars-Ausgabe wird es bei der Lenos-Edition leider nicht reichen, meint Georg Sütterlin, der umsomehr begrüßt, dass der Schweizer Verlag sich vor allem um die Bücher Cendrars' bemüht, die bislang noch nicht auf Deutsch veröffentlicht waren. So auch "Die rote Lilie", ein autobiografischer Roman, entstanden 1946, der Cendrars' Erlebnisse an der Front im Ersten Weltkrieg thematisiert. Ob es wohl an dem zeitlichen Abstand von fast dreißig Jahren zwischen dem Erlebten und der Niederschrift liegt, dass trotz schauderhafter Beschreibungen viele Schilderungen "wie in Watte gepackt" wirken, fragt Sütterlin. Vielleicht wollte der Autor sich aber auch nicht von seinen Gefühlen überwältigen lassen, mutmaßt der Rezensent; Cendrars war von einer Granate der rechte Arm abgerissen worden. Dank der gelungenen Übersetzung der erprobten Cendrars-Übersetzerin Giò Waeckerlin Induni wirkt das Buch auf Sütterlin frisch, mitreißend, oftmals sarkastisch und gespickt mit Details, die ein eindringliches Bild des absurden und abstumpfenden Alltags an der Kriegsfront liefern.
Kommentieren